Datenschutzmanagement birgt in seinem Kern das Risikomanagement. Dies ergibt sich aus der Datenschutz-Grundverordnung selbst: sie verlangt, Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen zu erkennen, zu bewerten und mit angemessenen Maßnahmen zu reduzieren. Datenschutz ist somit Teil eines fortlaufenden Risikoprozesses mit unmittelbarer Wirkung auf die Unternehmenspraxis.
Der Schlüssel zu einem stabilen Risikomanagement im Datenschutz besteht darin, die Brücke zwischen Verarbeitungstätigkeiten (VVT) und technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) zu schlagen. In vielen Unternehmen werden diese Elemente jedoch noch isoliert voneinander betrachtet:
Datenschutzdokumentation auf der einen Seite, Risikomanagement-Maßnahmen auf der anderen. Das führt dazu, dass Risiken und Maßnahmen ohne gegenseitigen Bezug nebeneinander bestehen - ein Zustand, der in heutzutage nicht mehr praktikabel ist.
Ein integrierter Ansatz aus Datenschutz und Risikomanagement dagegen sorgt für Konsistenz. Wenn Risiken, Gewährleistungsziele und TOM miteinander verknüpft sind, entsteht eine nachvollziehbare Logik: Jede Maßnahme zahlt auf ein konkretes Gewährleistungsziel ein, jede Risikoevaluierung ist sauber dokumentiert. So entsteht ein belastbares System, das nicht nur aufsichtsbehördlichen Prüfungen standhält, sondern auch operativ funktioniert.
Der folgende Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch die Phasen eines integrierten Risikomanagements: von der Erfassung über die Bewertung von Risiken bis hin zur Ableitung wirksamer technischer und organisatorischer Maßnahmen.

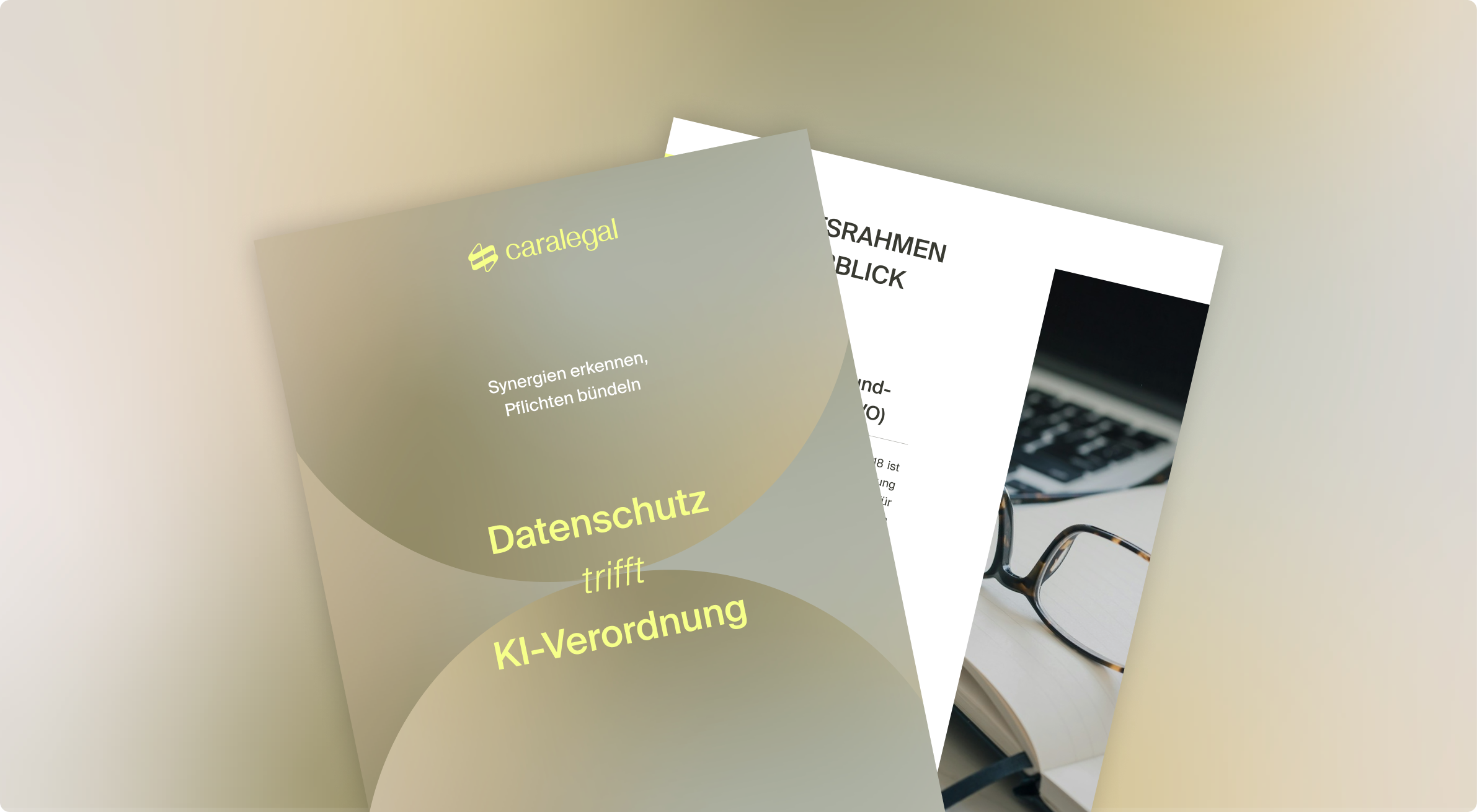
 en_US
en_US





